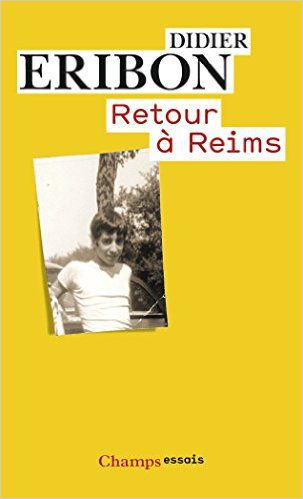
Didier Eribon: Retour à Reims
Die Herkunft lässt sich nicht verleugnen – Didier Eribons Autobiographie im Zeichen der sozialen Scham
Rezension von Christoph Oliver Mayer, erscheint in Romanische Studien (2017)
Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, übers. von Tobias Haberkorn (Berlin: Suhrkamp, 2016), 240 S.
Didier Eribon, Retour à Reims (Paris: Fayard, 2009), 247 S.
Wenig verwunderlich erscheint es, dass auf dem Buchdeckel der deutschen Ausgabe von Didier Eribons Autobiographie 2016 der Shootingstar der französischen Literaturszene und Eribon-Zögling Édouard Louis mit einer Lobeshymne zitiert wird, die Rückkehr nach Reims nicht nur als ein „überwältigendes literarisches Werk und die wichtigste soziologische Arbeit seit Bourdieus Die feinen Unterschiede“ bezeichnet, sondern es auch als „eines der sehr wenigen Bücher, die eine Revolte entzünden und den Lauf des Lebens verändern können“ beschreibt. Dies überrascht deshalb nicht, weil die verspätete deutsche Ausgabe des in Frankreich bereits sieben Jahre zuvor (2009) erschienenen Buches erst im Gefolge der beiden Bücher von Édouard Louis und insbesondere seines erfolgreichen Erstlingswerks En finir avec Eddy Belleguelle1 realisiert wurde. Während Eribons Autobiographie gleichsam die theoretische Grundlage für das Werk von Édouard Louis liefert und er in Frankreich insbesondere als Biograph von Michel Foucault2 und durch seine soziologische Arbeiten3 bekannt ist, bedurfte es in Deutschland wohl mehrerer Anstöße, um sich mit der Biographie eines schwulen französischen Intellektuellen und dessen proletarischer provinzieller Herkunft zu beschäftigen: Diese bestanden weniger aus den Debatten um die Homo-Ehe in Frankreich, eher noch, nach dem Trump-Schock, aus dem drohenden Wahlsieg von Marine Le Pen und damit aus einem gesteigerten Interesse für die Verhältnisse in Frankreich. Letzten Endes aber entscheidender war, dass Didier Eribons Thesen eine Lücke im politischen Diskurs in Deutschland füllen, was ihn insbesondere in Berlin 2016 zum ‚Lieblingsbuch vieler Linken‘ und zur Reibungsfläche linker Organe wie der taz werden ließ.
Die Gründe, sich für Rückkehr nach Reims zu interessieren, sind also vielfältig, wobei der literarische Wert oftmals (zu Unrecht) zu kurz kommt. Eribons autobiographischer Text ist jedoch nicht einfach die prototypische Lebensgeschichte eines letztlich arrivierten Soziologieprofessors der Universität Amiens, der in einem lumpenproletarischen Milieu in der nordfranzösischen Provinz aufgewachsen ist und sich erst spät, mit 55 Jahren, offen und ehrlich der eigenen Vergangenheit stellt. Didier Eribon (geb. 1953 in Reims) verbindet das autobiographische Schreiben auf innovative Art und Weise mit soziologischen Reflexionen zu verschiedenen Themenkomplexen, die in fünf Teilen und einem Epilog durchgespielt werden. Geschickt versteht er es, das Biographische zum Ausgangspunkt für seine wohlbegründeten Ansichten zu gesellschaftspolitischen Themen zu machen und dabei Erklärungsmuster zu finden, die französische Diskussionen kondensieren, welche als solche gerade in Deutschland bis dato viel zu wenig wahrgenommen worden sind. Damit erhält das Buch gerade im Jahr 2016 und für das deutsche Publikum inmitten von Debatten um die ‚Political Correctness‘ und um das ‚Postfaktische‘ neue Relevanz und Brisanz, was auch die Beachtung erklärt, die dem Buch nicht nur im Feuilleton zuteilwurde.
Der erste Teil erörtert die soziale Scham, die zum Ausgangspunkt des biographischen Schreibens wird. Der Anlass zur Rückkehr in die Heimat, d. h. zur Mutter, war die Alzheimer-Erkrankung und der spätere Tod des Vaters, mit dem zeitlebens eine Kommunikation unmöglich geblieben war:
Es war der Beginn einer Aussöhnung mit ihr. Oder genauer, eine Aussöhnung mit mir selbst, mit einem ganzen Teil meines Selbst, den ich verweigert, verworfen, verneint hatte. (11)
Den Impuls für die soziologische Spurensuche und das Wiedersehen mit einem ebenso konservierten wie negierten Selbst liefert also das Wiederaufflackern der Bindung an die Mutter. Eribon diagnostiziert für sich einen gespaltenen Habitus und eine melancholische Grundstimmung angesichts des erinnerten Arbeiterelends seiner Familie. Die Biographie füllt somit eine Lücke in seinem bisherigen Werk, das seinen Ausgang im Grunde aus der eigenen Homosexualität nahm. Der Autor gesteht dabei ein, dass er sich für die eigene Herkunft geschämt hat und analog zum für ihn schnell verlassenen „sexuellen Schrank“ jedoch lange Zeit im „sozialen Schrank“ lebte – ein Vergleich, der mit dem im Englischen etablierten „out of the closet“ spielt und im französischen als „placard sexuel“ ebenso wie als „placard social“ auch funktioniert, im Deutschen allerdings mehr als seltsam anmutet. Er habe früh mit seinem sozialen Milieu total brechen wollen, sich abgewandt und abgegrenzt, nun aber die Langzeitwirkungen der sozialen Exklusion erkannt, die er mit James Baldwin folgendermaßen als überzeitlich gültiges Kriterium unserer modernen Gesellschaft begründet: „Von Geburt an tragen wir die Geschichte unserer Familie und unseres Milieus in uns, sind festgelegt durch den Platz, den sie uns zuweisen.“ (46)
Nach diesem persönlichen Zugang über die soziale Scham, die er analog zur sexuellen Scham konstruiert, folgt im zweiten Teil eine nachhaltige Erklärung für die bestehende soziale Ungerechtigkeit, wobei Eribon interessante Bezüge zu der in Deutschland im Zuge der Bildungsstudien stets virulenten, in Frankreich aber schon weitaus länger geführten und spätestens mit Bourdieu etablierten Diskussion um die Bildungschancen aufzeigt. Nur dank der aufstiegsorientierten Mutter konnte Didier auf das Gymnasium, wo er zwar die Welt der Kultur, der Literatur und der Philosophie für sich entdeckte, wo er sich aber auch gleichsam egoistisch von seinen Brüdern distanzierte. Dieses Erfolgsmodell wird nicht als Vorbild für alle gepriesen, denn die Klassenflucht gelingt aufgrund der exkludierenden Wirkung des auf Klassenzugehörigkeit aufbauenden Schulsystems eben nicht allen und bringt Entwurzelung und Unverständnis mit sich. Doch nicht nur bei den unteren Schichten, sondern in der ganzen Gesellschaft werde dieser Mechanismus ignoriert: „Die Herrschenden merken nicht, dass ihre Welt nur einer partikularen, situierten Wahrheit entspricht […]“ (92). Hierfür wird John Edgar Wideman4 zu seinem Referenzautor, der vom „Krieg“ des Bürgertums und der herrschenden Klassen gegen die populären Klassen spricht und damit an Stelle des hier unausgesprochenen im Hintergrund aufblitzenden Michel Foucault genannt wird. Auch wenn Eribon diese Einschätzung einordnet, relativiert er diesen Ausdruck der Macht der sozialen Ordnung nicht und bezeichnet das Schulsystem sogar als „Höllenmaschine“, das die gesellschaftliche Ungleichheit verewigt. Zur Untermauerung der These verweist er z. B. auf die soziale Herkunft der Gefängnisinsassen, die hauptsächlich den unteren Klassen entstammen und gibt damit zu bedenken, dass der Klassenhabitus und die geringe Chancengerechtigkeit Bildungskarrieren vorzeichnen. Am Ende steht also eine Reproduktion der gesellschaftlichen Schichten, die, so wird hier unausgesprochen verstehbar, nur durch gesamtgesellschaftlichen Aufstiegswillen und Wertschätzung von intellektuellen Werten wie Kultur angeregt und durch die Einsicht in das Funktionieren der Gesellschaft realisierbar ist.
Im dritten Teil, der in den Pressemitteilungen hauptsächlich beachtet wurde, zeichnet Eribon die politische Entwicklung seines Elternhauses nach, die prototypisch für viele Französinnen und Franzosen von eingefleischten KP-Wählern hin zum Front National (FN) gewandert sind. Damit bietet er Erklärungsmuster für die gestiegenen Wahlergebnisse des FN gerade unter den Arbeitern an und übergeht gleichsam die einfachen Antworten („Protestwähler“), wie sie ähnlich ja auch in Deutschland angesichts Pegida und AfD vorschnell zu hören waren und sind. Die Wahl der rechten Parteien, so Eribon, sei genauso reiflich überlegt wie die jeder anderen Partei und sie gehe einher mit der stillen und heimlichen Verteidigung der eigenen Identität und der eigenen Würde, die im politischen Geschäft und bei den etablierten Parteien zunehmend verloren gegangen war. Die Wahl sei also eine „politische Notwehr der unteren Schichten“ (124) und insofern eine Art negativer Selbstaffirmation (125). Eine solche Perspektive erklärt den politischen Seitenwechsel von ganz links nach ganz rechts genauso wie die Akzeptanz rechter Parolen, wie sie sich in den seit langem bei den Wählern existierenden rassistischen (und auch homophoben) Reflexen wiederfinden. Das Neue daran ist nur, dass sich die Animositäten jetzt politisch auswirken, weil die Funktionsträger ebenfalls diese Reflexe ausleben, statt sie zu kanalisieren. Eribon spürt zur Untermauerung seiner These dem volkstümlichen Alltagsrassismus der 1960er Jahre nach und macht ihn als Überlegenheitsgestus gegen noch ärmere Gruppen verständlich. Er weist aber auch diejenigen Beobachter, die in den aktuellen politischen Umwälzungen einen epochalen Umbruch sehen, darauf hin, dass Arbeiter eben nicht von Hause aus links sind und sich solidarisch mit anderen Unterprivilegierten zeigen. Die Politikwissenschaft müsse folglich neue Perspektiven einnehmen, ist sie Eribon doch zu festgefahren im Links/Rechts-Schema; die Politikerinnen und Politiker wiederum müssten, wenn sie diesem Prozess zugunsten des FN, oder, so wäre zu ergänzen, der rechtspopulistischen und identitären Strömungen in Europa, gegensteuern wollen, die negativen Leidenschaften der Unterklassen (wieder) neutralisieren („neutraliser au maximum les passions négatives à l’œuvre dans le corps social“). Damit plädiert er keineswegs für die Rückkehr zur Kommunistischen Partei noch für autoritäre Lösungen, sondern zeigt auf, wie der Klassenhabitus den individuellen Habitus gerade in Krisenzeiten überlagert und wie, so wäre zu ergänzen, grundsätzlichere Interessen der Daseinsfürsorge Details wie Stil und Ästhetik im Umgang miteinander in den Hintergrund rücken.
Die Rekapitulation der eigenen Jahre auf dem Gymnasium wird im vierten Teil zu einer Auseinandersetzung mit Pierre Bourdieus Soziologie. Bourdieu hatte selbst kurz vor seinem Tod 2001 einen soziologischen Selbstversuch5 fertig gestellt, der als Selbstanalyse Eribon nicht weit genug geht und für ihn die Logik der sozialen Kräfte nicht ausreichend berücksichtigt:
Bourdieu nennt keines der Bücher, die er las, er sagt nichts über die Menschen, die für ihn wichtig waren und die ihn auf den Geschmack von Kultur und Philosophie brachten […]. (154)
im Original:
Il ne mentionne aucun des livres qu’il lisait, ne donne aucun renseignement sur ceux qui comptèrent pour lui ou lui donnèrent le goût de la culture, de la pensée, […].
Leider ist gerade an dieser Stelle die Übersetzung nur wenig hilfreich, da sie weder adäquat die Bourdieu’schen Begriffe überträgt, noch die Nuancen der Feld- und Habitustheorie verständlich machen kann. Der „Geschmack von Kultur“ transportiert eben etwas Anderes als den Sinn für Kultur und für das Denken, den Bourdieu selbst im Begriff des „goût“, einem zentralen Element seiner Studie zum Geschmack,6 verortet. Bourdieus Selbstportrait, dessen Leerstellen mit Ausnahme der sexuellen Identitätsfindung im Übrigen auch auf Édouard Louis übertragbar wären, bleibt für Eribon insbesondere unvollständig, weil Bourdieu eben nichts zur eigenen Sexualität sagt und seine homophobe Umgebung ausgeblendet habe. Eribon weist dagegen in seinen autobiographischen Retrospektiven darauf hin, wie er sich aufgrund seiner sexuellen Andersartigkeit von typischem Unterschichtsverhalten abgegrenzt habe, wie an die Stelle des Männlichkeitskults Bildung und Kultur getreten seien und er sich schließlich dann auch erfolgreich an die Kultur der Schule und des Lernens anpassen konnte. Der Kontakt mit Bürgerkindern und vor allem die Schwärmerei für einen Professorensohn, der sich in gleichsam allem (Name, Wohngegend, Hobbies, Geschmack, Schreibweise) von ihm selbst unterschied, hatten in ihm den „Geschmack der Bücher“ (167) geweckt und seinen Weg in die literarische Abschlussklasse und hin zu den Geisteswissenschaften geebnet. Liebe und Bildung gehen also eine motivierende Allianz ein, die die geheime Logik der Gesellschaft gleichsam indirekt ergründet.
An dieser Stelle werden weitere überaus interessante Einsichten in das Funktionieren des sozialen Feldes geschildert, die gleichsam Bourdieus Theorien am exemplarischen Beispiel transparent machen. Erst die doppelte Distanzierung vom Herkunftsmilieu und die sexuelle wie soziale Distanznahme ermöglichen den Aufstieg, verhindern aber zeitlebens dessen wahres Gelingen. Ohne das Wort ‚Scheitern‘ in den Mund zu nehmen und damit eine letztlich geglückte Berufskarriere aus der Sicht der Oberklasse zu relativieren und sich der Unterschicht und ihrer Distanz zu den Bildungsinstitutionen anzubiedern, versucht Eribon den Spagat zwischen diesen beiden unversöhnlichen Welten. Schon am Ende der Schulzeit wird die Unmöglichkeit einer Chancengleichheit offensichtlich, wenn der junge Didier in seinem Karriereplan an die Bildungsmöglichkeiten der französischen Eliten mit ihren Grandes Écoles und den Vorbereitungskursen gar nicht denkt: „Jugendliche aus der Arbeiterklasse wussten nicht einmal von deren Existenz“ (172). Am Ende steht unweigerlich für jeden Emporkömmling ein Ausschluss aus den oberen Schichten: „Der Abstieg mag langsamer verlaufen, der Ausschluss später stattfinden, aber der Abstand zwischen Herrschenden und Beherrschten bleibt konstant“ (173). Die vermeintliche Demokratisierung und Chancengleichheit ist für Eribon in Realität also nur eine Parallelverschiebung des gesellschaftlichen Koordinatensystems. Denn insbesondere die eigenen Vorlieben sind vom Klassenhintergrund geprägt, genauso aber verrät auch das Verhalten immer die Herkunft: Didier muss für das Studium arbeiten, versucht sich vergeblich an der agrégation, erhält schließlich nur dank eines Stipendiums die Möglichkeit, nach Paris zu ziehen, wo er seine maîtrise cum laude besteht und ein Doktorat aufnimmt. Allerdings macht sich dort immer noch die eingeschränkte Chancenauswahl bemerkbar, wenn er selbst im Elfenbeinturm der Philosophie noch ein sehr konservatives Thema (Hegel und Sartre) und damit die sichere Seite wählt, statt sich mit den Poststrukturalisten zu beschäftigen, oder wenn er trotz Studienabschlusses nebenbei als Nachtportier arbeiten muss, denn: „Der wahre Wert eines Hochschulabschlusses hängt vom sozialen Kapital ab.“ (187)
Womöglich vergisst Eribon hier und auch dort, wo er Bourdieu kritisiert, dass nur die Einsicht in die Feldstrukturen und das gesellschaftliche Funktionieren ein klassenspezifisches Verhalten verhindern bzw. überwinden können. Die bewusste Verweigerung des Klassengeschmacks in Gestalt der Distanznahme zur sozialen Herkunft erstreckt sich auch auf Lebensformen und Verhaltensweisen, die nicht Halt machen vor Interessensfeldern oder ökonomischen Zwängen. Das Arbeiten-Müssen ist eben eine Selbstzuschreibung gesellschaftlicher Zwänge, die die Selbstversorgung zum verinnerlichten und von der Umgebung eingeforderten Ideal des Arbeiterkindes erheben, während die arrivierten Bürgerkinder allenthalben aus anderen Motiven als der Subsistenz arbeiten, einschlägige Berufserfahrungen machen und sich dergestalt einen professionellen Habitus zulegen können. Das Ausbrechen aus diesem Teufelskreis geht nur einher mit ökonomischen (weniger Geld) und emotionalen (weniger familiäre bzw. soziale Anerkennung) Einbußen. Entsprechende Verhaltensweisen bedingen Aufstiegschancen und so mag es für den zukünftigen Soziologieprofessor ein geringes oder gar kein Reputationsdefizit darstellen, als Nachtportier gearbeitet zu haben, von einem Richter oder Arzt hingegen würde man dies eher weniger erwarten.
Im fünften Teil versucht Eribon hingegen, die Ausgrenzung durch Mitmenschen, die alltäglichen Beleidigungen, denen Schwule ausgesetzt sind, und die Gewalt als Begründung für seinen Lebenslauf (im Sinne von Bourdieu wäre von trajectoire zu sprechen) heranzuziehen. Das eigene Begehren muss verheimlicht werden und kann nur an einschlägigen Begegnungsorten (lieux de drague) der Szene ausgelebt werden, die gleichsam zum Lernort für den homosexuellen Habitus in Abwehr der habituellen Homophobie werden und besser auch Cruising-Orte genannt werden sollten. Diese schwule Sozialisierung, die ein Leben jenseits der (sexuellen) Norm ausbildet, vollzieht sich nolens volens, da in Anlehnung an Eve Kosofsky Sedgwick7 sich der epistemologische Vorteil der Heterosexuellen, die eben keine Gewalterfahrungen oder Polizeikontrollen und damit keine diskursiv-kulturellen Aggressionen erfahren müssen, bis hinein in die Wissenschaft ausdrückt, die ihrerseits immer noch nach Ursachen forscht und Störungen vermutet. Daher gelte, was Sartre in seinem Buch zu Genet formuliert habe: „es kommt darauf an, was wir aus dem machen, was man aus uns gemacht hat“ („L’important n’est pas ce qu’on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-même de ce qu’on a fait de nous.“). Das Bekenntnis zur schwulen Identität und den Umgang mit den gesellschaftlichen Zuschreibungen zur sexuellen Andersartigkeit sieht Eribon bei sich selbst als diesbezüglich gelungen an, das zur sozialen Herkunft allerdings nicht. Oder man könnte es auch so ausdrücken: die schwule Community hat ihm den Weg dorthin geöffnet, wohin er als Proletarier aus der Provinz nicht gelangt wäre. Die reibungslose Karriere blieb ihm so aber versagt.
Dieser Bilanz des Scheiterns durch die soziale Herkunft und am Eingestehen dieser Herkunft, die ursächlich für die autobiographische Studie und die darin eingebettete soziologische Abhandlung ist, wird ein Epilog hinterher geschoben, der diese Zwiespältigkeit noch unterstreicht. Die eigene Erfolgsbahn – „was ich heute bin, geht auf die Verflechtung zweier Projekte zurück“ (223) – beruht auf dem freien schwulen Leben in Paris und deren Subkultur, kennt aber gerade in dem nur langsam erfolgten Aufstieg im intellektuellen Milieu klassenspezifische Dämpfer. Erst über die Freundschaft zu Michel Foucault und den Kontakt zu Pierre Bourdieu sowie nach einigen gescheiterten Romanprojekten und journalistischen Frustrationen gelangte Eribon zu sich selbst und seinen soziologischen Studien, die er nun einer kritischen Relektüre unterzieht. Mit Annie Ernaux8 teilt er die Erkenntnis, dass das Individuum immer und unweigerlich mehreren Gruppen angehört. Letztlich ist er trotz seiner Herkunft oder gerade deshalb Professor für Soziologie geworden, was die Mutter angesichts des ihr unvertrauten Faches zu der Frage antrieb: „[H]at das was mit der Gesellschaft zu tun?“ (238), die schließlich zum Schlusssatz der Biographie geworden ist und die Leserinnen und Leser etwas betrübt, ob der beschränkten Weltsicht und der Bloßstellung der Mutter, in der sich ein letzter Distanzierungsreflex der ‚lumpenproletarischen‘ Herkunft zeigt, zurücklässt. Die individuelle Wahl des Anderssein, die hier in Gestalt des Habitus als inkorporiert und nicht gewählt, aber auch nicht als hinzunehmendes Schicksal erscheint, ermöglicht also den Übergang in eine andere gesellschaftliche Welt, zumal zum Habitus des schwulen Intellektuellen im poststrukturalistischen Frankreich der 1980er Jahre auch eine Einsicht in das Funktionieren des gesellschaftlichen Aufstiegs gehört.
Da Einsicht und soziologische Analyse schon bei Bourdieu den ersten Schritt zu einem kritischen politischen Engagement darstellten, überrascht es, wie stark die Distanzierungsreflexe von Eribons Gesellschaftsanalyse gerade in der deutschen Linken nachwirkten und wie sehr das Buch einerseits hochgelobt, angepriesen und empfohlen, andererseits aber auch kritisch beäugt wurde. Kurzum: Eribon hat sieben Jahre nach seinem Erscheinen den Nerv des Jahres 2016 in Deutschland voll getroffen. Dass gesellschaftliche Realitäten und die konzise Logik der gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen benannt wurden, führte wohl zu Betroffenheit und somit mitunter zu direkter Ablehnung: „Für Linke kann es deshalb nur heißen: Eribon nein danke!“9. Mal wurde ihm unter völliger Verkennung des Habitus-Konzepts die autoritäre Geringschätzung des autonomen Individuums vorgeworfen,10 wobei ihm gleichzeitig fehlender Humor und Selbstdistanz zugeschrieben wurde, da er, so das Totschlagargument par excellence, zu sehr aus der Opferrolle heraus schreibe. Mal scheint es die (wenn überhaupt, dann sowieso nur indirekte) Kritik Eribons an der neoliberalen Sozialdemokratie zu sein, gepaart mit seiner Kompromisslosigkeit hinsichtlich der politischen Förderung von sozialer Distinktion, die angesichts des zunächst überwiegenden Lobs Rückkehr nach Reims und seinem Autor mittlerweile auch Kritiken eingebracht hat.
Teilweise würdigten deutschsprachige Rezensenten durchaus die Erkenntnisse, die Eribons Buch – ähnlich wie Carolin Emckes jüngste, allerdings deutlich weniger theoriegeleitete Beiträge – für den öffentlichen Diskurs gerieren: „Um Hass und Populismus etwas entgegenzusetzen, braucht es kritische Auseinandersetzung mit symbolischen Ausschließungsmechanismen und Analysen der Materialität wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Entwicklungen.“11 Dergestalt zeigt sich der Erfolg des Buches als das Ergebnis eines Erklärungshungers angesichts von AfD und Brexit12 und visiert naturgemäß auch einen einschlägig politisch wie intellektuell vorgeprägten Leserkreis an bzw. Eribon verlangt die Bereitschaft, sich im Rahmen eines autobiographischen Textes nicht nur auf Erzählungen, sondern auch auf Interpretationen einzulassen.
In Frankreich, wo das Buch zum Zeitpunkt seines Erscheinens 2009 positiv wahrgenommen wurde, die darin transportierten Inhalte aber durchaus bereits längst bekannt waren, wurde hingegen zeitgleich die Adaption von Retour à Reims zu einem gleichnamigen Theaterstück durch Laurent Hatat diskutiert, das den Dialog zwischen Mutter und Sohn zum Ausgangspunkt nahm und im April 2016 Premiere feierte: „Car au-delà de cette histoire familiale surgissent les dérives et les échecs de la société française“.13 Neben den gesellschaftlichen Erklärungsmustern heben französische Rezensenten zumeist die besondere Stilistik des Romans hervor und erste Detailstudien rühmen dessen literarische Qualität:
il se situe entre le « je transpersonnel » de l’écrivain Annie Ernaux, reconstituant une réalité familiale, sociale, générationnelle à travers ses récits à la première personne, et l’Esquisse pour une auto-analyse, de Pierre Bourdieu (Raisons d’agir, 2004), qu’il commente longuement en une sorte de dialogue poursuivi avec le sociologue disparu.14
Der Roman harrt also einer literaturwissenschaftlichen Analyse, die ihn zum einen in autobiographische Tendenzen wie bei den genannten Annie Ernaux und Édouard Louis einreiht, zum anderen aber auch Bezüge zu schwulen Vorreitern wie Jean Genet, Guy Hocquenghem oder Hervé Guibert genauso herstellt wie zur sozialkritischen Literatur, wie sie sich in Verbindung mit Homosexualität insbesondere in Großbritannien entwickelt hat (vgl. etwa Jonathan Harvey oder Hanif Kureishi).
Letztlich gilt das, was ein anderer Rezensent, Joachim Zinsen, treffend auf den Punkt bringt:
Diese völlig unterschiedlichen Ansätze geben dem Buch eine ungeheure Dichte, machen es einerseits zu einem menschlich tief anrührenden Stück, andererseits zu einer brillanten Milieustudie.15
- Édouard Louis, En finir avec Eddy Belleguelle (Paris: Seuil, 2014) bzw. Édouard Louis, Das Ende von Eddy, übers. von Hinrich Schmidt-Henkel (Berlin: S. Fischer, 2015).↩
- Didier Eribon, Michel Foucault, 1926–1984 (Paris: Flammarion, 1989).↩
- Zu nennen sind v. a. Didier Eribon, Réflexions sur la question gay (Paris: Fayard, 1999) und Didier Eribon, Une morale du minoritaire (Paris: Flammarion, 2015).↩
- John Edgar Wideman, Fanon (Boston: Houghton Mifflin, 2008).↩
- Die Rede ist von Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse (Paris: Raisons d’agir, 2004).↩
- Pierre Bourdieu, La distinction (Paris: Minuit, 1979).↩
- Insbesonders zu nennen ist Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991).↩
- Unter anderem: Annie Ernaux, Les années (Paris: Gallimard, 2008).↩
- „Bewegung,“ taz, die tageszeitung, 15.12.2016, 36.↩
- Philipp Tingler, „Scham und Klasse,“ Tages-Anzeiger, 14.12.2016, 2.↩
- Fred Luks, „Populismus: Brot und Spiele,“ Der Standard, 9.11.2016, 39.↩
- Christiane Müller-Lobeck, „Negative Leidenschaften; Klassengesellschaft,“ taz, die tageszeitung, 23.7.2016, 15.↩
- Sandrine Blanchard, Retour à Reims: une douloureuse ascension sociale,“ Le Monde.fr, 30.6.2015.↩
- Jean-Louis Jeannelle, „Didier Eribon, du verdict sexuel à la honte sociale,“ Le Monde des livres 30.10.2009, 9.↩
- Joachim Zinsen, „Wo sich die Linke selbst erledigt hat,“ Aachener Nachrichten, 27.9.2016, 8.↩